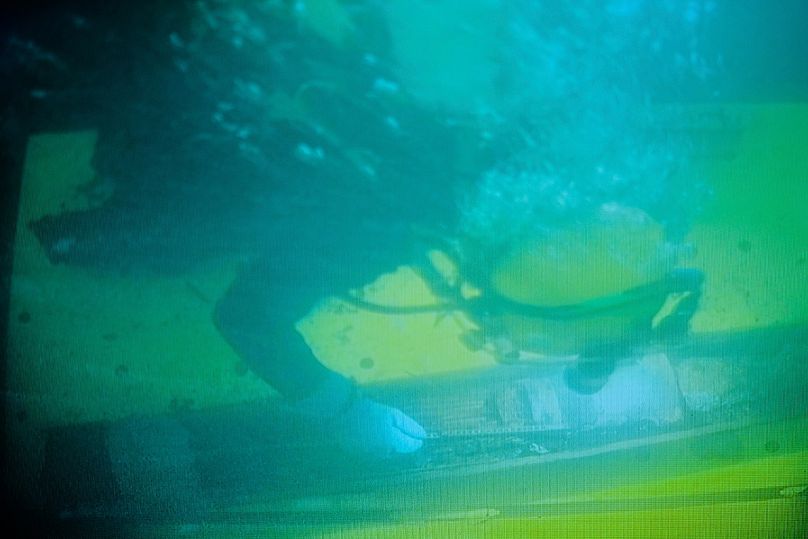Etwa 1,6 Millionen Tonnen Munition aus dem Zweiten Weltkrieg liegen auf dem Meeresboden. Aus den Waffen treten giftige Verbindungen aus, die die Meerestiere und das Ökosystem der Ostsee bedrohen.
Langsam taucht Dirk Schoenen zu einem riesigen Munitionshaufen aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Grund der Ostsee hinab.
Er nimmt einige der oberen Teile heraus und legt sie vorsichtig in einen Korb. Dabei beobachtet wird er von einem Team aus Ingenieuren, Tauchern und Seeleuten. Jede seiner Bewegungen wird auf Monitoren beobachtet, die Live-Videos von einer an seinem Kopf befestigten Kamera übertragen.
Nach einer Stunde zieht die Crew Schoenen zurück auf den Baltic Lift, eine mobile Plattform, die 6 Kilometer vor der kleinen Stadt Boltenhagen an der deutschen Küste liegt. Er hat mehrere 12,8-Zentimeter-Granaten geborgen, von denen einige noch in einer zerbrochenen Holzkiste stecken, sowie Fragmente kleinerer Granaten und mehrere 2-Zentimeter-Geschosse.
Seine Ausbeute war ergiebig, aber bescheiden im Vergleich zu dem, was sich auf dem Meeresboden befindet.
Etwa 1,6 Millionen Tonnen alter Munition liegen auf dem Grund der Nord- und Ostsee und stellen eine erhebliche Gefahr dar: Ihre Hülsen rosten langsam und geben giftige Stoffe wie TNT-Verbindungen ab.
Europa räumt mit dem Chaos des Zweiten Weltkriegs auf, während ein neuer Konflikt mit Russland droht
Die Spannungen zwischen Russland und der NATO in der Ostsee haben sich verschärft. Fast täglich kommt es zu Zwischenfällen, bei denen Unterseekabel sabotiert werden, NATO-Kampfflugzeuge versuchen, russische Militärflugzeuge abzudrängen, und feindliche Drohnen aus dem Osten in den westlichen Luftraum eindringen, sind die Europäer immer noch damit beschäftigt, das Chaos aufzuräumen, das der Zweite Weltkrieg und in geringerem Maße auch der Erste Weltkrieg im Meer hinterlassen haben.
Der größte Teil der Munition wurde nach dem Krieg absichtlich im Meer versenkt, weil die Alliierten befürchteten, dass Deutschland die Feindseligkeiten gegen sie irgendwann wieder aufnehmen würde, und anordneten, dass Deutschland alle Munition vernichtet. Damals schien es der einfachste Weg zu sein, alles einfach ins Meer zu werfen.
Züge aus ganz Deutschland wurden 1946 an die Küsten geschickt, und Fischer damit beauftragt, das Material in die vorgesehenen Entsorgungsgebiete in der Ost- und Nordsee zu bringen. Oft warfen sie die Munition aber auch an anderer Stelle ins Meer, und starke Strömungen, vor allem in der Nordsee, haben die Kampfmittel über den gesamten Meeresboden verteilt.
In dem Bemühen, den Meeresboden von den Überresten des Krieges zu säubern, hat die deutsche Regierung 100 Millionen Euro für Taucherteams bereitgestellt, die untersuchen sollen, wie die Munition am besten geborgen werden kann, und für Ingenieure, die langfristige Pläne zur Beseitigung der Munition in den Meeren entwickeln sollen.
Das derzeitige vierwöchige Pilotprojekt begann im August auf der Plattform Baltic Lift, einem selbstfahrenden Kranschiff, das vorübergehend vor Boltenhagen festgemacht ist. Hier entdeckten die Experten ein großes Feld mit rund 900 Tonnen alter Munition.
Zwei Taucherteams sind in 12-Stunden-Schichten rund um die Uhr im Einsatz. Da es zu gefährlich ist, die verrottenden Teile auf die Plattform zu bringen, werden sie zunächst sortiert und in Körben unter Wasser gelagert, bis ein Spezialschiff sie an Land bringt. Erst dann werden sie zu Einrichtungen gebracht, die auf die Entsorgung von Altmunition spezialisiert sind.
Gefahr von spontanen Explosionen und Kontaminationen
"Das ist keine Routinearbeit", sagt der 60-jährige Dirk Schoenen, der seit 1986 taucht und sich ehrenamtlich für das Baltic Taucher Team engagiert.
"Die Herausforderung besteht natürlich darin, dass man nie weiß, was einen erwartet", sagte er, während er sich aus seiner Tauchausrüstung schälte. Er trug auch drei Paar Handschuhe, um sicherzustellen, dass seine Haut nicht direkt mit der Munition in Berührung kam.
"Die meisten dieser Dinge kann man handhaben, aber man darf die Vorsicht nicht vernachlässigen und einfach wahllos auf etwas einschlagen oder etwas wegwerfen."
Die verrottende Munition verseucht nicht nur das Wasser, sie kann auch explodieren, da die Zünder von Seeminen und nicht explodierten Fliegerbomben mit der Zeit immer empfindlicher werden. Das kommt in seltenen Fällen vor.
Schlimmer noch, die 80 Jahre alte Munition beginnt auch, die Meeresumwelt zu vergiften. Zerfallende Fragmente von TNT-Sprengstoffen, die als krebserregend gelten, wurden im Wasser in der Nähe von alter Munition auf dem Meeresboden entdeckt.
Nach Angaben des deutschen Umweltministeriums, das bei den Aufräumarbeiten federführend ist, haben sich die von den Sprengstoffen stammenden Substanzen in Meereslebewesen wie Muscheln und Fischen angereichert.
Die festgestellten Giftstoffmengen lagen zwar weit unter den Grenzwerten für Trinkwasser oder Meeresorganismen, doch in einigen Fällen "näherten sich die Konzentrationen kritischen Werten", so das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel in einer im Februar veröffentlichten Studie.
Das Forschungsinstitut betonte "die dringende Notwendigkeit der Munitionsräumung, um langfristige Risiken zu minimieren".
Das Problem ist in der Ostsee besonders dringlich, da sie durch einen schmalen Kanal mit der nahe gelegenen Nordsee und dem Atlantik verbunden ist, was bedeutet, dass das verschmutzte Wasser jahrzehntelang nicht aus dem Gebiet herausfließt, so das deutsche Umweltministerium.
Andere Länder haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen
Das Regierungsprojekt konzentriert sich nicht nur auf die Reinigung des Meeresbodens. Langfristiges Ziel ist es, sichere Wege zu finden, um die Munition zu bergen. Sie soll dann sofort zerstört werden, idealerweise mit automatischen Mitteln ohne die Hilfe von menschlichen Tauchern und durch Verbrennung des giftigen Materials in einer schwimmenden Industrieanlage auf See.
Das aktuelle Projekt und drei verwandte, von der Regierung geförderte Projekte aus dem Jahr 2024, bei denen Unterwasserroboter zur Untersuchung des Meeresbodens eingesetzt wurden, werden dazu beitragen, zu ermitteln, wie solche Offshore-Anlagen konzipiert werden sollten, sagte Volker Hesse, ein Meeresingenieur, der das Programm koordiniert.
Hesse betonte, dass die Ergebnisse nicht nur für Deutschland wichtig seien, sondern auch für andere Länder von großem Interesse, da im Meer versenkte Altmunition weltweit ein wachsendes Problem darstelle.
Er wies darauf hin, dass auch das Schwarze Meer mit dem Problem der Verschmutzung durch Munition aus Russlands Krieg in der Ukraine konfrontiert ist.
"Dies ist definitiv ein globales Problem, man denke nur an die Krisen in Vietnam oder Kambodscha, aber auch hier vor Ort in den Nachbarländern, in der Ostsee, in Dänemark, in Polen", sagte er.